«Der Patient soll die bestmögliche Therapie erhalten und sich zu jedem Zeitpunkt gut aufgehoben fühlen.»
Die Diagnose Krebs ist für die meisten Patientinnen und Patienten ein Schock. Sie und ihr Umfeld sehen sich von einem Moment auf den anderen mit einer neuen Situation konfrontiert. Dann braucht es Kompetenz und Empathie, um ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein Gespräch mit Dr. med. Ruth Gräter, Fachärztin für Radio-Onkologie und Strahlentherapie, Prostatazentrum Bern.
Welche guten Botschaften fallen Ihnen zu den Themen Radio-Onkologie und Krebs ein?
Dr. med. Ruth Gräter: 40 bis 60 Prozent aller an Krebs erkrankten Patientinnen und Patienten werden mit der Radiotherapie behandelt. Zirka 50 Prozent der bestrahlten Betroffenen können wir heilen. Das ist eine gute Botschaft. Die Radiotherapie ist eine starke Therapieoption. Gleichzeitig ist sie die preiswerteste. Das ist die zweite gute Nachricht. Diesen Punkt kann man angesichts der ständig steigenden Gesundheitskosten gar nicht genug hervorheben. Die Radio-Onkologie ist ein wichtiger Pfeiler der onkologischen Therapie.
Spielt dabei auch das Radiotherapiegerät «Ethos» eine Rolle?
Dr. med. Ruth Gräter: Ethos oder vielmehr die damit verbundene Software kann durch eine aktualisierte Berechnung der Dosis auf bewegliche Organe Einfluss nehmen. Dadurch können wir den Behandlungsplan täglich anpassen. So erzielt die Bestrahlung bestmögliche Ergebnisse und die umliegenden Organe werden weniger belastet. Bei Tumoren im Beckenbereich ist Ethos sehr wirksam. Aber nicht bei allen Tumoren macht eine Behandlung mit Ethos Sinn. Es gilt somit, die passende Technik für den jeweiligen Einsatz zu wählen.
Ist die technische Ausstattung für Patientinnen und Patienten ein Kriterium bei der Wahl des Spitals?
Dr. med. Ruth Gräter: Ja, es gibt Patientinnen und Patienten, die sich gezielt vorher informieren. Manchmal erweckt ein modernes Gerät den Eindruck einer moderneren Therapie. Das ist jedoch nur zum Teil richtig. Mit moderneren Techniken können wir mehr Dinge einbeziehen. Dass dies aber nicht immer für alle Betroffenen von therapeutischem Nutzen ist, wissen die Patientinnen und Patienten oft nicht.
Sind Informationen aus dem Internet hilfreich oder eher störend?
Dr. med. Ruth Gräter: Als Frage formuliert, sind Informationen immer willkommen. Bestärken sie jedoch lediglich die eigene Meinung und blockieren so fachliche Einschätzungen, sind sie nicht hilfreich. Gute Informationen sind ein Fundament. Sie helfen, einen Weg zu finden, mit der Erkrankung umzugehen und Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die sich in diesem Augenblick richtig anfühlen. Ich kenne einige Beispiele von Patientinnen und Patienten, die sich gut informiert haben. Die sich aber trotz aller Chancen und Möglichkeiten für die – rein nach der Studienlage – schlechtere Variante entschieden haben. Weil diese zum Beispiel für sie persönlich eine bessere Lebensqualität bietet. Darum empfehle ich meinen Patientinnen und Patienten gerne, dass sie, neben allen rationalen Argumenten, auch darauf hören sollen, was sich für sie richtig anfühlt. Manchmal kann eine Kleinigkeit den Ausschlag geben. Dann ist dies für sie die beste Variante.
«Wir begleiten die Patientinnen und Patienten vom ersten Kontakt bis in die Nachbehandlung hinein.»
Was bedeutet es für Sie, dass der Mensch im Mittelpunkt steht?
Dr. med. Ruth Gräter: Der Betroffene wird mit einer Diagnose konfrontiert. Er ist von einem Moment auf den anderen in eine andere, eine neue Situation hineingeworfen. Darauf müssen sich nun diese Person und ihr ganzes Umfeld einstellen. Wir begleiten die Patientinnen und Patienten vom ersten Kontakt bis in die Nachbehandlung hinein. Dabei ist es uns wichtig, zu wissen, dass es diesem Patienten in seinem individuellen Setting gut geht. Somit stellen wir ihn in den Mittelpunkt unserer interdisziplinären Betreuung. Er soll die bestmögliche Therapie erhalten und sich zu jedem Zeitpunkt gut aufgehoben fühlen. Dafür gilt es, eine gemeinsame Vertrauensbasis zu schaffen.
Was verstehen Sie unter einer bestmöglichen Therapie?
Dr. med. Ruth Gräter: Das ist sehr individuell. Meine Aufgabe liegt darin, den Patientinnen und Patienten die Möglichkeiten der Behandlung auf verständliche Weise näherzubringen. Also zum Beispiel die Vor- und Nachteile einer Bestrahlung gegenüber einem chirurgischen Eingriff und umgekehrt. Daher frage ich auch immer explizit: Haben Sie ausreichend Informationen, um entscheiden zu können? Manche brauchen nicht viele Informationen, da muss ich mich beinahe aufdrängen. Andere wiederum sagen mir, dass sie nun so viel gehört haben, dass sie sich nicht entscheiden können. Diesen Patientinnen und Patienten schlage ich vor, einen Tag lang nur eine Option zu durchdenken. Und dann anschliessend einen weiteren Tag der Alternative zu widmen. Zu schauen, wie sich beides anfühlt, und erst dann zu entscheiden. Das hat meist geholfen.
«Manchmal sind Angehörige jedoch noch stärker belastet als der Betroffene selbst.»
Wie wichtig ist Empathie bei diesen Gesprächen?
Dr. med. Ruth Gräter: Die ärztliche Fachexpertise ist die Voraussetzung, um sich auf dem Feld der therapeutischen Möglichkeiten sicher bewegen zu können. Sie befähigt uns, den Patientinnen und Patienten aus Leitlinien und Studien das beste Wissen vermitteln zu können. Die Empathie hilft uns, dieses Wissen auf eine Art und Weise zu vermitteln, die der jeweiligen Situation entspricht. Diese Situationen sind immer besonders. Erhalten die Patientinnen und Patienten die Diagnose, sind sie aufgeregt. Sie wissen nicht, wie sehr sie das Ganze belasten, beeinträchtigen oder sogar verändern wird. All diese Unsicherheiten müssen wir zunächst auffangen, bevor wir mit Fakten beginnen können.
Empathie schafft somit eine Verbindung, um Kompetenz wirksamer zu entfalten?
Dr. med. Ruth Gräter: Ja, deshalb frage ich zunächst einmal nach, was die Patientin oder der Patient verstanden hat. Was die Diagnose betrifft, die Behandlungsmöglichkeiten und auch die Radiotherapie. Dann höre ich den Betroffenen zu und versuche herauszufinden, was sie beschäftigt. Ich spreche mit ihnen über ihre Ängste, ihre Sorgen und ihre Nöte. Erst dann vermittle ich der Patientin oder dem Patienten die notwendigen Informationen. Bei der Art der Kommunikation gehe ich auf die jeweilige Situation ein. So kann ich die grössten Belastungen etwas abfedern, damit die Patientin oder der Patient die Informationen überhaupt wahrnehmen kann. Es gibt aber auch Situationen, die so stark belastet sind, dass ich ein zweites Gespräch vorschlage.
Wie viel nehmen die Patientinnen und Patienten aus dem Erstgespräch mit?
Dr. med. Ruth Gräter: Nur etwa 2 Prozent der vermittelten Informationen können wirklich aufgenommen werden. Unser Gehirn nimmt auf verschiedenen Wegen Informationen auf, zum Beispiel durch Sehen oder Fühlen. Diese unbewussten Eindrücke, die wir ohne Worte wahrnehmen, sind wichtig. Das Gehirn entscheidet schnell, ob es diese Reize als angenehm oder bedrohend bewertet. Das bestimmt entscheidend die Möglichkeit des Gehirns, das gesprochene Wort aufzunehmen. Manchmal sind Angehörige jedoch noch stärker belastet als der Betroffene selbst. Dann ist das rationale Übermitteln von Informationen zu diesem Zeitpunkt nicht gut möglich. In diesem Fall sprechen wir mehrheitlich über begleitende Faktoren, beispielsweise Lebensumstände, Krankheitsverlauf oder Ziele. Anschliessend vereinbaren wir einen weiteren Gesprächstermin, um die fachlichen Informationen zu besprechen.
Wie wichtig sind Angehörige in diesem Prozess?
Dr. med. Ruth Gräter: In den allermeisten Fällen sind die Angehörigen eine grosse Hilfe. Es ist wichtig, dass sie erfahren, welche Herausforderungen auf die Patientin oder den Patienten zukommen. In der Regel möchten die Betroffenen alles gut machen. Sie strengen sich an und tun alles, um die Angehörigen nicht zu belasten. Die Angehörigen hingegen unternehmen alles, damit es der oder dem Betroffenen gut geht. Das ist dann sehr hilfreich. Sie spornen die Patientin oder den Patienten an, etwas zu tun. Manchmal kann das der oder dem Betroffenen auch zu viel werden. Sie oder er aber traut sich nicht, dies den Angehörigen zu sagen. Auch für solche Situationen möchten wir Betroffene und Angehörige schon im Vorfeld sensibilisieren. Darum laden wir immer gerne eine Bezugsperson zum Gespräch ein. Also die Partnerin oder den Partner, die Angehörigen oder auch die Freundin oder den Freund. Genesung braucht Zeit und Geduld. Dabei gibt es gute und schlechte Tage – für die Patientinnen und Patienten wie auch für die Angehörigen.
«Entsteht eine mitmenschliche Nähe, ist das ein grosses Geschenk.»
Ist auch Sexualität ein Thema in Ihren Gesprächen mit Patientinnen und Patienten?
Dr. med. Ruth Gräter: Unbedingt. Das ist wichtig, selbst wenn es für die Patientin oder den Patienten «kein Thema» ist. Bei Prostatakrebs ist deshalb auch die Partnerin oder der Partner wichtig. Auch sie sollten wissen, welche Auswirkungen diese Erkrankung und die Therapien auf den Betroffenen haben. Sowohl die OP als auch die Bestrahlung und auch die Hormontherapie beeinflussen die funktionale Sexualität. Innerhalb der Beziehung kann das idealerweise zu Fragen führen. Fragen wie zum Beispiel: Wie können wir als Paar damit umgehen? Oder können wir andere Formen der Zärtlichkeit finden? Weiterhin ermutigen die Ärztinnen und Ärzte die Paare, auch andere Formen der körperlichen Nähe zu erkunden. Damit sie auch künftig Intimität leben können und als Paar nicht einfach damit aufhören. Intimität kann ein Kitt sein.
Kosten empathische Beziehungen zu den Menschen auch Kraft?
Dr. med. Ruth Gräter: Entsteht eine mitmenschliche Nähe, ist das ein grosses Geschenk. Kommt eine Patientin oder ein Patient in die Sprechstunde zu mir, bin ich ganz für sie oder ihn da. Und es gelingt mir auch, loszulassen, wenn dieser Mensch geht. Kommt er zu einem anderen Zeitpunkt zurück, ist das häufig ein vertrautes Wiedersehen. Man freut sich, diesen Menschen erneut zu begleiten. Selbst wenn er vielleicht in einer Phase zurückkehrt, die aus medizinischer Sicht wenig Hoffnung lässt.
Sprechen Sie auch über den Tod und das Sterben?
Dr. med. Ruth Gräter: Der Tod ist Teil des Lebens. In unserer Gesellschaft hat er jedoch kaum Platz. Wir beschäftigen uns zu wenig mit dem Thema Sterben. Menschen auch in dieser letzten Phase des Lebens zu begleiten, ist ein Geschenk. Es birgt immer auch die Möglichkeit, selbst als Mensch zu reifen.
Können Sie sich an einen konkreten Fall erinnern, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Dr. med. Ruth Gräter: Das Schönste für mich ist, einen Menschen zu befähigen, sein Leben wieder zu gestalten. Auch in seiner neuen Verletzlichkeit. Ich hatte einen für Prostatakrebs jungen Mann im Alter von etwa 50 Jahren. Er hatte mehrere Kinder, war beruflich sehr eingespannt und von sehr sensiblem Charakter. Er ist fast daran zerbrochen, was die Diagnose für seine Familie bedeutet. Mehr noch für seine Lieben als für ihn selbst. Das hat ihn so beschäftigt, dass er nahezu keine Kraft mehr hatte, sich aktiv in die Therapie zu begeben. Wir haben unzählige Gespräche geführt. Er hat auch mit vielen Menschen hier ein tolles Verhältnis aufgebaut. Nach und nach konnte er sich auf die Therapie einlassen und sie auch annehmen. Irgendwann hat er sich dann entschlossen, sich einen langgehegten Traum zu erfüllen: allein auf Pilgerfahrt zu gehen. Er hatte das schon früher mal vorgesehen, aber aus verschiedenen Gründen immer wieder zurückgestellt. Als er die Radiotherapie abschliessen konnte, sprühte er vor Kraft und Mut, sein Leben nochmals neu auszurichten. Da bekomme ich heute noch eine Gänsehaut.

«Der Austausch mit anderen Patienten ist sehr wertvoll.»
Für die meisten Patienten sind die Begriffe «schwer krank» und «grosse Operation» gleichbedeutend mit Schmerzen und einem langen Aufenthalt im Spital. Umso überraschter sind sie, wenn sie hören, dass ...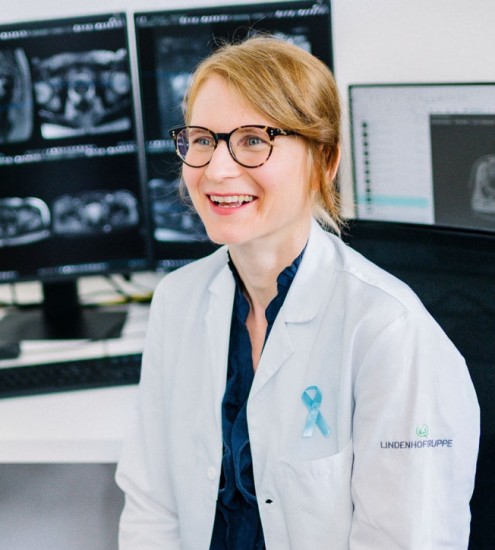
«Ein gutes Screening hilft, schon frühzeitig gezielte Massnahmen zu ergreifen.»
Je früher ein Tumor nachgewiesen werden kann, desto eher geht man davon aus, dass es sich um kleinere Tumore handelt und man gezielter Massnahmen ergreifen kann. Eine gute Botschaft, die auch für die ...
«Ich habe selten eine solche Bündelung an Engagement gesehen.»
Die PSMA-Positronen-Emissions-Tomografie hat die Diagnostik revolutioniert. Seit 2017 leistet sie auch in der Schweiz einen wertvollen Beitrag, um Prostatakrebs möglichst präzise zu diagnostizieren. ...
«Nichts ist bei der Behandlung von Krebs wichtiger als die persönliche Betreuung.»
Die Bevölkerung nimmt Krebs als höchst lebensbedrohlich wahr. Krebs ist jedoch längst kein Todesurteil mehr. Auch die Nebenwirkungen sind nicht mehr mit denen der Anfänge der Krebstherapie zu ...


