«Ich habe selten eine solche Bündelung an Engagement gesehen.»
Die PSMA-Positronen-Emissions-Tomografie hat die Diagnostik revolutioniert. Seit 2017 leistet sie auch in der Schweiz einen wertvollen Beitrag, um Prostatakrebs möglichst präzise zu diagnostizieren. Parallel hat sich die PSMA-Therapie zu einer der wichtigsten Behandlungsoptionen des Prostatakrebses in Spätstadien entwickelt. Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Ali Afshar-Oromieh, Facharzt für Nuklearmedizin und Kooperationspartner der Lindenhofgruppe.
Welche Vorteile bieten nuklearmedizinische Verfahren für Patienten mit Prostatakrebs?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Im Bereich Prostatakrebs gehören nuklearmedizinische Verfahren zu den präzisesten. 2011 wurde ein neues Verfahren zur Erkennung von Prostatakrebs vorgestellt: die PSMA-Positronen-Emissions-Tomografie in Kombination mit der Computertomografie (PSMA-PET/CT). Dieses bildgebende Verfahren stellt einen grossen Fortschritt dar und hat sich weltweit rasant ausgebreitet. Seit Januar 2017 ist es auch in der Schweiz verfügbar. Das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) ist ein Oberflächenmolekül. Bei Prostatakrebs ist es häufig übermässig vorhanden. Je nachdem, welches radioaktive Isotop man an die PSMA-Medikamente anhängt, kann man damit sowohl Diagnostik als auch Therapie betreiben. Die Therapie mit PSMA-Medikamenten wurde ebenfalls 2011 erstmals angewendet und hat sich ebenso weltweit ausgebreitet. Mittlerweile ist die PSMA-basierte Diagnostik und Therapie fester Bestandteil der klinischen Routine. Die PSMA-PET/CT leistet einen wichtigen Beitrag zu einer möglichst präzisen Diagnose – und damit auch zu einer möglichst präzisen Therapie. Und die PSMA-Therapie zeigt häufig sehr gute Erfolge.
Verringern sich durch die hohe Präzision der Verfahren auch die Nebenwirkungen?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Ganz genau. Die PSMA-PET/CT als eine präzise Diagnostik hilft, im Anschluss eine Über- oder Untertherapie zu vermeiden. PSMA kann man aber auch – wie erwähnt – für eine zielgerichtete Prostatakrebstherapie mit radioaktiven Isotopen nutzen. Diese Behandlungsmethode kommt aktuell bei Spätstadien des Prostatakrebses zum Einsatz. In diesen Stadien ist naturgemäss mit keiner Heilung zu rechnen. Dennoch sieht man durch die PSMA-Therapie regelmässig hocherfreuliche Ergebnisse mit einer deutlichen Lebensverlängerung bei sehr guter Lebensqualität. Durch die Präzision des Verfahrens ist die Therapie meist auch sehr gut verträglich. Die Pharmaindustrie arbeitet übrigens mit Hochdruck daran, die PSMA-Therapie auch in früheren Stadien, in denen eine Heilung des Prostatakarzinoms noch möglich ist, zuzulassen.
Kann man die Lebensverlängerung durch die PSMA-Therapie in Zahlen fassen?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Bisher gab es in den späten Krankheitsstadien keine Behandlung, die das Leben spürbar verlängern konnte. Mit der PSMA-Therapie haben wir nun eine Möglichkeit, das Überleben im Durchschnitt um etwa 4 Monate gegenüber der bisherigen Standardtherapie zu verlängern. Das klingt vielleicht nicht nach sehr viel, aber gerade in dieser späten Phase der Erkrankung ist es sehr schwierig, wirksame Therapien zu finden. Deshalb ist es ein wichtiger Fortschritt, dass uns die PSMA-Therapie seit einigen Jahren zur Verfügung steht. Ausserdem sehen wir immer wieder einzelne Patienten, die besonders stark von der Behandlung profitieren und deutlich länger leben, als man es normalerweise erwarten würde.
Ist dieses Verfahren mit Nebenwirkungen verknüpft?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Das Prinzip, das hinter der PSMA-Diagnostik und Therapie steht, ist, dass man recht spezifische Medikamente entwickelt, die zu Prostatakarzinomherden gehen. Diese Medikamente tragen Radioaktivität in sich. Sie bringen also die Strahlen gezielt zu den Stellen, an denen sich der Prostatakrebs befindet. Es ist jedoch prinzipiell so, dass auch andere Körpergewebe das Medikament speichern können. Im Rahmen der PSMA-Diagnostik ist die Strahlenbelastung für die Patienten gering. Bei der PSMA-Therapie muss man das Thema differenzierter betrachten. In der Regel ist diese Therapie sehr gut verträglich. Je häufiger ein Patient jedoch die Therapie erhält, desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Nebenwirkungen auftreten. Im Rahmen der üblichen PSMA-Therapien bei Prostatakrebs sind die Nebenwirkungen jedoch tolerabel und bedeuten keine relevante Einschränkung des Lebens. Schlägt die Therapie an, verspürt der Patient sogar deutlich weniger tumorbedingte Beschwerden wie Schmerzen oder Kraftverlust. Unter einer wirkungsvollen Therapie ist somit eine deutliche Steigerung der Lebensqualität möglich. Der Patient kann seinen Alltag wesentlich aktiver gestalten als noch zuvor.
Ist Strahlenschutz noch ein Thema?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Der Strahlenschutz zieht sich wie ein roter Faden durch unsere nuklearmedizinische Tätigkeit. Das beginnt bei der Diagnostik, bei der wir auch bewusst auf hochempfindliche PET/CT-Geräte, die sogenannten Ganzkörper-PET/CT-Geräte, setzen. Diese sind viel teurer als normale PET/CT-Geräte. Durch sie sind wir aber imstande, die Strahlenbelastung der Patienten deutlich zu reduzieren – und das sogar bei gleichzeitig viel besserer Bildqualität als mit herkömmlichen PET/CT-Geräten. Das kommt all unseren Patientinnen und Patienten zugute. Auch was den Strahlenschutz im Rahmen der nuklearmedizinischen Therapien betrifft, setzen wir auf unsere langjährigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Arbeiten. Wir können sehr gut abschätzen, welche Strahlendosen eingesetzt werden sollten, damit keine Über- oder Untertherapie erfolgt. Auch wenn die Patientinnen und Patienten uns nach erfolgter Therapie verlassen, nehmen wir unsere Pflicht, die Strahlenbelastung zu minimieren, sehr ernst. Wir sprechen ausführlich mit ihnen, um sie zu beraten, wie sie die Strahlenbelastung für sich und ihr Umfeld minimieren.
«Ich habe selten eine solche Bündelung an Engagement gesehen.»
Sie sind Kooperationspartner. Was macht die Lindenhofgruppe im Bereich Onkologie besonders?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Ich schätze die Kolleginnen und Kollegen der Lindenhofgruppe sowohl menschlich als auch fachlich ausserordentlich. Ich habe selten eine solche Bündelung an Engagement gesehen. Ihre Sympathie, Zuverlässigkeit, klare Kommunikation und fachliche Exzellenz ergeben ein äusserst überzeugendes Gesamtpaket. Auch als externer Kooperationspartner erfahre ich grosse Wertschätzung – die Zusammenarbeit macht mir grosse Freude.
Die Lindenhofgruppe verbindet Expertise mit Empathie. Wie nehmen Sie dies wahr?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Das kann ich absolut bestätigen. Die Patientinnen und Patienten, die aus der Lindenhofgruppe zu uns zur Behandlung kommen, sprechen sehr wertschätzend über die Kolleginnen und Kollegen dort. Aus meiner Sicht ist die Kombination von Expertise und Menschlichkeit bei allen Kolleginnen und Kollegen äusserst harmonisch. Das ist auch das, was die Patientinnen und Patienten spüren.
Was beschäftigt Patientinnen und Patienten am meisten bei der nuklearmedizinischen Behandlung?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Die Sorge, ob die Therapie wirkt, wie lange sie wirkt und ob sie ihnen eine bessere Lebensqualität ermöglicht. Das beschäftigt alle.
«Jeder, der einmal ernsthaft krank gewesen ist und eine Behandlung erhalten hat, wird eine angenehme Atmosphäre sehr schätzen.»
Welche guten Botschaften fallen Ihnen ein, wenn Sie an Prostatakrebs und Nuklearmedizin denken?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Erstens, dass eine neue Therapie auf dem Markt angekommen ist, die sogar in Spätstadien des Prostatakarzinoms sehr effektiv sein kann. Eine Therapie, die sehr gute Chancen auf eine Lebensverlängerung bei einer guten Lebensqualität bietet. Sie ist zudem in der Regel sehr gut verträglich. Der Aufenthalt in der Nuklearmedizin wird von den Patienten als angenehm empfunden. Wir befinden uns in einem hellen Gebäude mit grosszügigen und modernen Zimmern. Auf unserer Therapiestation herrscht eine fast klosterartige Ruhe, die unsere Patienten als sehr wohltuend erleben.
Wie wichtig ist das Umfeld und die Gestaltung der Räumlichkeiten?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Ich erachte beides als sehr wichtig. Die Patienten erleiden im Rahmen ihrer Krankheitsdiagnose eine enorme psychische Belastung: Die Erkrankung schwebt Jahre über Jahre wie ein Damoklesschwert über ihnen. Sie beeinträchtigt die Patienten und ihr Umfeld jeden Tag. Liegt eine neue Therapieoption an, stellen sich viele Fragen: Wird die Therapie wirken? Stellen sich Nebenwirkungen ein? Wo wird die Therapie stattfinden? Bin ich gut aufgehoben? Das sind in dieser persönlichen Ausnahmesituation sehr wichtige Aspekte für die Menschen. Jeder, der einmal krank gewesen ist und eine Behandlung erhalten hat, wird eine angenehme Atmosphäre während der Therapie sehr schätzen.
Beeinflussen diese Faktoren auch den Behandlungserfolg?
Prof. Dr. Ali Afshar-Oromieh: Mit dieser Frage beschäftigt man sich seit Menschengedenken. Das Thema ist aber wissenschaftlich sehr schwer zu fassen. Letztendlich schadet es auf keinen Fall, wenn man mit einer gestärkten psychischen Einstellung Therapien durchläuft. Als Ärztin oder Arzt muss man jedoch vorsichtig sein, wie man die potenziellen Erfolgsaussichten einer Therapie kommuniziert. Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, erst grosse Versprechungen zu machen, um dann die Betroffenen nach dem ersten Zyklus der Behandlung mit einer anderen Realität zu konfrontieren. Am Anfang kommt jeder mit der Hoffnung, dass eine Therapie auch wirklich wirkt. Man muss daran glauben und darauf hoffen, aber sollte keine unrealistischen Erwartungen hegen. Vor allem in den Spätstadien einer Erkrankung. Meine Devise lautet: Wir hoffen das Beste und bleiben optimistisch, aber letztlich muss man schauen, wie der Tumor auf eine spezielle Behandlung reagiert. Wenn er gut reagiert, sind alle glücklich. Wenn nicht, wechseln wir zu einer anderen Lösung.

«Der Austausch mit anderen Patienten ist sehr wertvoll.»
Für die meisten Patienten sind die Begriffe «schwer krank» und «grosse Operation» gleichbedeutend mit Schmerzen und einem langen Aufenthalt im Spital. Umso überraschter sind sie, wenn sie hören, dass ...
«Der Patient soll die bestmögliche Therapie erhalten und sich zu jedem Zeitpunkt gut aufgehoben fühlen.»
Die Diagnose Krebs ist für die meisten Patientinnen und Patienten ein Schock. Sie und ihr Umfeld sehen sich von einem Moment auf den anderen mit einer neuen Situation konfrontiert. Dann braucht es ...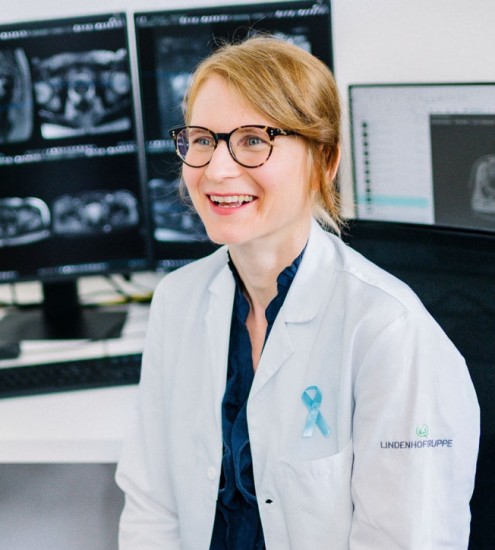
«Ein gutes Screening hilft, schon frühzeitig gezielte Massnahmen zu ergreifen.»
Je früher ein Tumor nachgewiesen werden kann, desto eher geht man davon aus, dass es sich um kleinere Tumore handelt und man gezielter Massnahmen ergreifen kann. Eine gute Botschaft, die auch für die ...
«Nichts ist bei der Behandlung von Krebs wichtiger als die persönliche Betreuung.»
Die Bevölkerung nimmt Krebs als höchst lebensbedrohlich wahr. Krebs ist jedoch längst kein Todesurteil mehr. Auch die Nebenwirkungen sind nicht mehr mit denen der Anfänge der Krebstherapie zu ...


